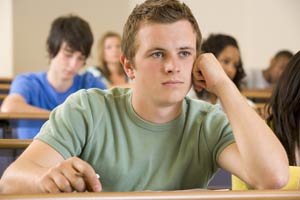Neuer Leistungsort für elektronische Dienstleistungen
Ab dem 1. Januar 2015 liegt der Leistungsort bei Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehleistungen sowie auf elektronischem Weg erbrachten Dienstleistungen an Nichtunternehmer in dem Staat, in dem der Kunde wohnt oder ansässig ist. Damit erfolgt die Umsatzbesteuerung dieser Leistungen künftig einheitlich nicht mehr in dem Staat, in dem der leistende Unternehmer ansässig ist, sondern am Verbrauchsort.
Als Folge davon müssen sich Unternehmer entweder in den anderen EU-Staaten umsatzsteuerlich erfassen lassen und dort ihren Melde- und Erklärungspflichten nachkommen oder die Sonderregelung "Mini-One-Stop-Shop" in Anspruch nehmen. Diese Regelung ermöglicht es Unternehmern, ihre in anderen EU-Mitgliedstaaten ausgeführten Umsätze, die unter die Sonderregelung fallen, in einer besonderen Steuererklärung zu erklären, diese Steuererklärung zentral über das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu übermitteln und die fällige Steuer insgesamt zu zahlen.
Eine Einschränkung gibt es aber: Die Sonderregelung gilt nur für Leistungen an Nichtunternehmer in EU-Staaten, in denen der Unternehmer keine umsatzsteuerliche Betriebsstätte hat. Außerdem müssen Unternehmer über die im Rahmen der Sonderregelung getätigten Umsätze Aufzeichnungen führen, die es ermöglichen Steuererklärung und Zahlungen auf Richtigkeit zu prüfen. Diese müssen dem BZSt oder den zentral zuständigen Behörden der übrigen EU-Mitgliedstaaten auf Anforderung auf elektronischem Weg zur Verfügung gestellt werden. Die Aufbewahrungsfrist für die Aufzeichnungen beträgt zehn Jahre.
Deutsche Unternehmen können beim BZSt die Teilnahme am Mini-One-Stop-Shop beantragen, und zwar unter der Webadresse https://www.elsteronline.de/bportal. Eine andere technische Herausforderung für Unternehmer ist, dass sie ab dem 1. Januar 2015 in ihren Online-Shops immer den korrekten Umsatzsteuersatz des jeweiligen Landes, in dem der Kunde ansässig ist, ausweisen und anwenden müssen. Außer einem Verweis auf die Steuersätze der verschiedenen EU-Staaten gibt es dazu aber keine Hilfe vom BZSt. Dafür bietet aber die EU-Kommission ein Internetportal an, in dem umfangreiche Informationen zu den neuen Regeln enthalten sind.
Jetzt Rückruf anfordern
Sie haben Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail.